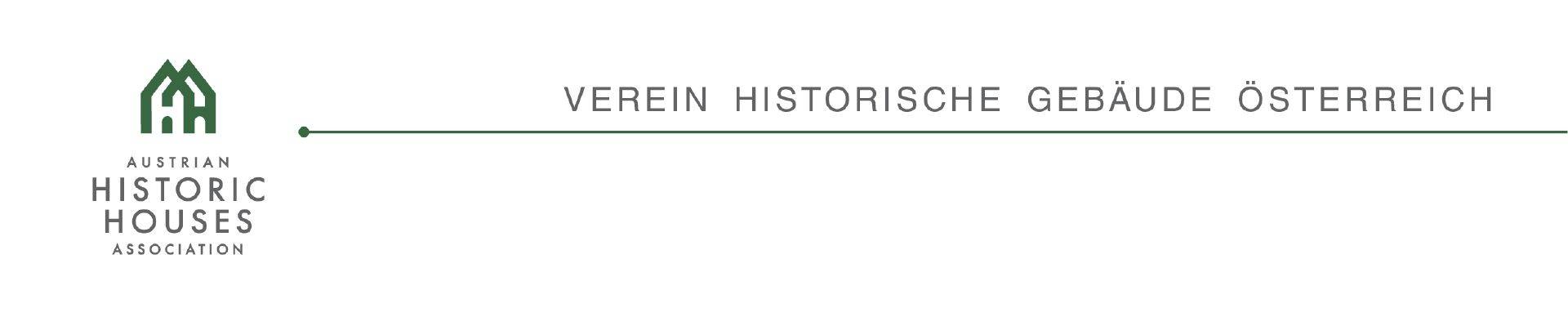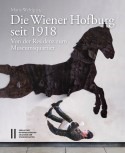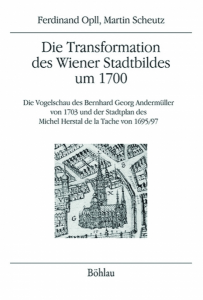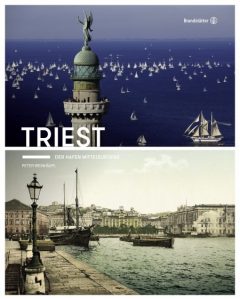Privates baukulturelles Erbe unter Druck

Ein Artikel aus Der Standard 14.11.2018, der auch unter nachstehendem Link abrufbar ist:
https://derstandard.at/2000091209408/Privates-baukulturelles-Erbe-unter-Druck
Privates baukulturelles Erbe unter Druck
In Österreich beträgt die Sanierungsquote nur ein Prozent. Zur Werterhaltung historischer Bausubstanz braucht es allerdings eine Quote von drei Prozent
Was wäre Österreich ohne denkmalgeschützte Bauten? Ohne die reizenden Stadt- und Dorfkerne, ohne die Altstädte von Innsbruck, Salzburg, Enns, Dornbirn, Linz oder Graz? Ohne Stifte und Klöster? Graz ohne Uhrturm und Salzburg ohne Festung? Was wäre Österreich ohne Burgen, Schlösser, ohne die zahlreichen Objekte, die wir unser baukulturelles Erbe nennen und die ein unverzichtbarer Bestandteil unserer gemeinsamen lokalen und europäischen Identität sind?
Derzeit stehen in Österreich 39.000 unbewegliche Objekte rechtskräftig unter Denkmalschutz. Davon ist circa je ein Drittel im Eigentum von Privaten, von Religionsgemeinschaften sowie von Firmen, Stiftungen und öffentlichen Körperschaften.
Lösung gegen Bodenfraß
Die 13.000 denkmalgeschützten Immobilien ausschließlich in privater Eigentümerschaft haben immer mehr unter den völlig inadäquaten Bauvorschriften und hohem Kostenrisiko zu leiden. Viele historische Bauten sind bereits dem Verfall preisgegeben, weil immer mehr private Eigentümer mit der Erhaltung wirtschaftlich und finanziell überfordert sind. Baufachleute nennen als Ziel eine Sanierungsquote von jährlich drei Prozent zur Werterhaltung der historischen Bausubstanz. Derzeit liegt Österreich bei kaum einem Prozent, was langfristig zwangsläufig zum Einsturz, Abbruch und Verschwinden alter oft landschaftsprägender Bauten führt.
Dabei könnten denkmalgeschützte Häuser in bestehenden Stadt-, Markt- und Dorfkernen konkrete Lösungen zum immer wieder öffentlich kritisierten „Bodenfraß“ leisten. Derzeit wird in Österreich täglich eine Fläche von rund 20 Hektar verbaut. Das entspricht einer Fläche von etwa 30 Fußballplätzen. Befund der Statistik Austria: In den vergangenen 15 Jahren ist die österreichische Bevölkerung um kaum neun Prozent gewachsen, während im selben Zeitraum die verbauten Flächen um rund 24 Prozent wesentlich dynamischer zugenommen haben.
Bürokratie und Kostenrisiko minimieren
Das Thema der Erhaltung alter Gebäude im Privatbesitz wird immer drängender, weil der Druck auf Eigentümer, Planer und alle dafür Verantwortlichen durch eine Vielzahl von Gesetzen und Normen laufend wächst. Hauptproblem ist, dass viele für Neubauten bestimmte Normen genauso für alte Bürgerhäuser aus der Gotik-, Renaissance- oder Barockzeit Geltung haben – die technischen Bauvorschriften und Bauordnungen ebenso wie die Energiesparbestimmungen, Bestimmungen zu Barrierefreiheit und Feuerschutz, Wohnbauförderungsrichtlinien, aber auch Haftungsfragen.
Ein Denkmal ist kein Neubau und deshalb kostenintensiver. Der Präsident der oberösterreichischen Gesellschaft für Landeskunde und Denkmalpflege und vielgeprüfter Erneuerer von zahlreichen denkmalgeschützten Häusern, Schlössern und Objekten, Georg Spiegelfeld, forderte dazu kürzlich, „dass Bürokratie und Kostenrisiko so weit minimiert werden müssen, dass Investoren im Zweifelsfall sich eher für die Nutzung eines denkmalgeschützten Objektes entscheiden, statt an der Peripherie einer Stadt wertvollen landwirtschaftlichen Grund zu verbrauchen“.
Dafür sprechen auch rein volkswirtschaftliche Argumente, weil diese Bauten bereits alle Anschlüsse der Infrastrukturnetze haben, im Gegensatz zu Projekten auf der grünen Wiese: Kanal- und Wasserleitungen, Straßen, Strom, Energie, Glasfaserinternet sind im Bestand meist schon vorhanden. Kosten, die Gemeinden – zumindest teilweise – sparen könnten.
Keine bloße Liebhaberei
Erstes Ziel im noch laufenden „Europäischen Jahr des kulturellen Erbes 2018“ müsste sein, die besondere Problemlage auch im internationalen beziehungsweise europäischen Vergleich aufzuzeigen und konkrete Verbesserungsvorschläge zu präsentieren. Dabei muss vermerkt werden, dass im Arbeitsprogramm der Regierung dieses Thema auch enthalten ist und der zuständige Kulturminister dafür bereits Gesprächsbereitschaft bekundet hat.
Die Sanierung historischer Gebäude kostet mehr als ein Neubau. Das müsste im Steuer- und Abgabenrecht wegen des öffentlichen Interesses berücksichtigt werden. Daher zwei konkrete Forderungen:
- Weg mit der Liebhaberei-Vermutung, wenn das Bundesdenkmalamt bestätigt, dass die Investition im Sinne des Denkmalschutzes durchgeführt wurde.
- Sonderausgaben sollen in unbegrenzter Höhe für einen Eigentümer möglich sein, wenn er in ein Denkmal investiert.
Beide Punkte sind nachweislich auch ein Investitionsförderprogramm für Gewerbe und Handwerksberufe, wie erst kürzlich der Volkswirt der JKU-Linz, Friedrich Schneider, in einer Studie feststellte.
Arbeit für Handwerk und Gewerbe
So fließen bei einer Gesamtinvestition zur Sanierung eines Altbaus von einer Million Euro rund 600.000 Euro an Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsgebühren wieder in öffentliche Kassen zurück. Insbesondere deshalb, weil bei Bauten dieser Art praktisch keine Großmaschinen verwendet werden können, damit der Lohnanteil rund 90 Prozent und der Materialanteil etwa zehn Prozent beträgt. Damit würde sich ein Förderpaket des Staates mittelfristig weitestgehend „selbst tragen“, und die zurückfließenden Steuergelder würden keine zusätzlichen Budgetmittel erfordern.
Wenn ein Denkmaleigentümer zu wenig Kapital für die Erhaltung hat und Fremdkapital benötigt, soll ein Investitionsförderprogramm Kredite mit Bestkonditionen garantieren, wenn diese in die Denkmalpflege fließen. Auch die Grundsteuer für denkmalgeschützte Objekte soll fallen. Oft werben Gemeinden sogar mit Denkmälern. Damit könnten sie zumindest einen symbolischen Beitrag zur Denkmalpflege leisten.
Wert und Sinn
Investitionen in denkmalgeschützte Bauten fördern Österreichs Identität, Architektur, Regionalität, Tourismus, Arbeit, Beschäftigung und schonen Bauland auf der grünen Wiese. In ihnen stecken Wert und Sinn. Es gilt, unserer gemeinsamen europäischen Verantwortung für das baukulturelle Erbe in Österreich gerecht zu werden. (Gottfried Kneifel, 14.11.2018)
European Heritage Photographer of the year



Press Release
The European Historic Houses Association is pleased to announce the top three winners of its 2018 photo contest.
The competition was launched in May 2018, during the European Private Heritage Week http://www.europeanhistorichouses.eu/eych-2018/european-private-heritage-week/. With 250 entries, we are proud to have captured the diversity and beauty of astonishing private historic houses and gardens in various European countries (http://heritagephotos.eu/events/european-historic-housing-association/).
Based on our terms and conditions (private historic houses, located in Europe, interesting historical background and not highly manipulated) and a serious selection procedure, we are pleased to announce that the official jury[1] awarded:
Joint 1st Prize: Dreamland, the Festetics-Batthány Castle, taken by Gabriella Funtig and the Syon House in London, taken by Simon Hadleigh-Sparks.
2nd Prize: The Blessed Trinity, taken by Declan Hackett
Together with sixteen other pictures, they have exposed during the European Historic Houses Association Annual Conference in the EU Committee of the Regions and will be disclosed throughout 2018 and 2019 various locations.
The team of the European Historic Houses Association would like to congratulate all the winners and the various photographers who posted their pictures online!!


1] The Jury consisted of recognized photographers and EU representative, namely Mr. Oliver Curtis and Mr. Mark Thackara from the United Kingdom, Mr. Jean Pierre Gabriel from Belgium and Ms. Catherine Magnant, Deputy head of Unit of the Directorate-General for Education and Culture from the European Commission.
European Heritage Awards
24.09.2018
Die Einreichung zu den Awards 2019 ist offen!
Aufruf zur Einreichung von Projekten zum “Preis der Europäischen Union für das Kulturerbe | Europa Nostra Preis 2019” (European Heritage Awards | Europa Nostra Awards 2019) [weiterlesen]
Denkmalschutz in Österreich
„Ziegler“ seit rund 400 Jahren
Suchen Sie einen Restaurator
Literatur für den Herbst
Ein General für alle Jahreszeiten
Ende August 2018 waren es genau 26 Jahre, dass General Emil Graf Spannocchi, einer der bemerkenswertesten Persönlichkeiten des Österreichischen Bundesheeres, nach einem Reitunfall in Wiener Neustadt verstarb. Er erhielt ein Begräbnis mit militärischen Ehren, eine Vorgangsweise, die auch heute noch höchst unüblich ist. Doch damit unterstrich die Republik Österreich, dass Spannocchi als der bisher bedeutendste General der Nachkriegszeit gelten kann.
Seine Karriere beim Bundesheer der Ersten Republik begann er als Einjährig-Freiwilliger beim Dragonerregiment und nach dem erzwungenen Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurde er in die Deutsche Wehrmacht übernommen. Als Oberstleutnant und dann als Rittmeister folgten Einsätze in Holland und Frankreich sowie an der Ostfront. Er ersparte in einer Einzelaktion vielen österreichischen Soldaten die russische Gefangenschaft, wurde zweimal verwundet und geriet zu Kriegsende in US-Kriegsgefangenschaft.
Nach Tätigkeiten in der Privatwirtschaft sowie der B-Gendarmerie wurde er Kommandant beim Bundesheer, ehe er die Landesverteidigungsakademie leitete bzw. Armeekommandant wurde.
Sein Name war eng mit dem Konzept der „Raumverteidigung“ verbunden. Nach diesem als „Spannocchi-Doktrin“ bekannten Raumverteidigungskonzept wurde das Bundesheer in den Jahren 1973 bis 1986 umorganisiert. Das Konzept sah den Kampf und die starke Verteidigung von Schlüsselzonen vor, die mit Bunkern, vorbereiteten Sperren, Feldsperren, Sprenganlagen und starken Einheiten geschützt waren.
Der Frage, ob Spannocchi die Raumverteidigung selbst „aus der Taufe“ gehoben hatte, oder nur vortrefflich präsentieren konnte, sind die Autoren Mag. Georg Frh.v. Reichlin-Meldegg und Oberst i.R. Wolfgang Wildberger im militärhistorischen Fachmagazin „PALLASCH Nr. 65“ (Österr. Miliz-Vlg. Salzburg; eMail: milizverlag@miliz.at), das im Oktober 2018 erscheinen soll, ebenso nachgegangen, wie der Frage nach seinem persönlichen Verhältnis zu BK Dr.Bruno Kreisky, BM Bgdr Karl Baron Lütgendorf und anderer Entscheidungsträger im Bundesheer.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Die Wiener Hofburg seit 1918
Von der Residenz zum Museumsquartier
Reihe: Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse, Band: 447
Reihe: Veröffentlichungen zur Kunstgeschichte, Band: 16
Reihe: Veröffentlichungen zur Bau- und Funktionsgeschichte der Wiener Hofburg (Herausgegeben von Artur Rosenauer), Band: 5
Erscheinungsjahr: 2018
ISBN13: 978-3-7001-8028-9
Formularbeginn
Auch nach dem Ende ihrer Funktion als Residenz blieb die Wiener Hofburg mit ihren Gebäuden, Plätzen und Parks Schauplatz der politischen und kulturellen Zäsuren dieses Landes. Der Band behandelt die Bau-, Nutzungs- und Kulturgeschichte des ehemaligen Kaisersitzes, dem mittlerweile ein Jahrhundert republikanischer sowie, in Episoden, totalitärer Geschichte eingeschrieben ist und der mit der Errichtung eines Kulturzentrums der Gegenwart in den ehemaligen Hofstallungen zum zentralen Kunstfeld des Landes im 21. Jahrhundert avancierte
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Ferdinand OPLL, Martin SCHEUTZ
Die Transformation des Wiener Stadtbildes um 1700
Die Vogelschau des Bernhard Georg Andermüller von 1703 und der Stadtplan des Michel Herstal de la Tache von 1695/97
Mitteilungen des Instituts für Öst. Geschichtsforschung. Ergänzungsbände – Band 061
212 Seiten, gebunden
ISBN: 978-3-205-20537-1
Böhlau Verlag Wien
Formularbeginn
Der Dessauer Gesandte Bernhard Georg Andermüller (1644–1717) zeichnete während seines vierjährigen Wienaufenthalts eine faszinierende Karte des frühneuzeitlichen Wien, vermutlich im Auftrag seiner Anhalter Dienstgebers. Minutiös verzeichnete der Gesandte darin im Sinne eines Selbstzeugnisses eines Diplomaten Wohnorte und Entscheidungszentren der Residenz Wien im ausklingenden Zeitalter Leopolds I. Neben dieser Vogelschau verdeutlicht der Plan von Michel Herstal de la Tache aus dem Jahr 1695/97 ebenfalls den sich abzeichnenden Transformationsprozess der Stadt, von einer bürgerlichen Stadt hin zu einer Residenz und Adelsstadt nach der zweiten Belagerung der Stadt durch die Osmanen: die Festung Wien, die Neuformierung der katholischen Welt und der Adel finden darin deutlichen Niederschlag.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Peter WEINHÄUPL
Triest – Der Hafen Mitteleuropas
Nostalgischer Sehnsuchtsort für Kurzurlauber. Der erste Prachtband über den Hafen Mitteleuropas.
ISBN978-3-7106-0226-9
Format24 x 30 cmSeiten224Abbildungenca. 240EinbandHardcover mit Schutzumschlag
€ 50,00
Schmucke Gründerzeithäuser in einer der besterhaltenen Altstädte habsburgischer Prägung einerseits, rostige Hafenkräne und aufgelassene Magazine andererseits: willkommen in der Adria-Metropole Triest. Seit einiger Zeit weht Aufbruchsstimmung durch dieses „Wien am Meer“.
Nach seinem Prachtband über Grado spürt Peter Weinhäupl nun das historische Erbe Triests auf. Er fördert aus den Tiefen der Speicher des größten Gedächtnisses der Stadt Triest – den Archiven der ehemaligen Haupt-Reichs und Residenzstadt Wien – unbekanntes und kaum bearbeitetes Material aus über sechs Jahrhunderten zutage. Und lässt uns anhand von neu entdeckten Ansichten, Karten, historischen und aktuellen Fotografien und flankiert von Malern wie Egon Schiele oder Rudolf Kalvach, Literaten wie James Joyce, Italo Svevo und Herman Bahr oder Architekten wie Heinrich von Ferstl und Matthäus Pertsch diese faszinierende Stadt völlig neu erleben.
Peter Weinhäupl war als ehem. Managing Director des Wiener Leopold Museums u.a. Co-Kurator der Ausstellungen „Jugendstil pur. Joseph Maria Auchentaller“ (2009), „Rudolf Kalvach. Wien und Triest um 1900“ (2012) und „Egon Schiele und Triest“ (2014). Seit über 20 Jahren bereist der nunmehrige Chef der Klimt-Foundation das Gebiet des heutigen Friaul-Julisch-Venetien und gilt als ausgewiesener Kenner der Region.
Lehrgang Exklusives Haushaltsmanagement
Lehrgang Exklusives Haushaltsmanagement und Butler/Housemanager
Für eine optimale Schulung von Haushälterinnen und Butler werden interessierte Schlossbesitzer gesucht.
burgvereinPale Blue Dot
Pale Blue Dot – Eine künstlerische Intervention auf der Fassade Schloss Hornegg
Am 15. September wurde „Pale Blue Dot“, eine Intervention des steirischen Künstlers Berrnhard Wolf, auf Schloss Hornegg eröffnet.

Mit diesem Projekt erfährt die Fassade von Schloss Hornegg für eine unbestimmte Zeit zusätzliche Bedeutung und ist als Bildträgerin aufgewertet. Denn ihrer vergänglichen Repräsentanz wird eine weitere Bedeutungsebene hinzugefügt. Eventuelles Abbröckeln bemalter Stellen ist mit überlegt und wird nicht korrigiert werden.

Seine Gedanken zu Pale Blue Dot formuliert Bernhard Wolf folgendermaßen:
„auf den ersten blick ohne direkten bezug zur gestaltung an der fassade von Schloss Hornegg, eröffnet der titel pale blue dot eine zusätzliche dimension, in die weitest unvorstellbaren räume, die die menschliche existenz mit definieren. Pale Blue Dot (blassblauer Punkt) ist der Name eines Fotos der Erde, aufgenommen von der Raumsonde Voyager 1 aus einer Entfernung von etwa 6 Milliarden Kilometern oder 40,5 EA / Astronomischen Einheiten (1 EA entspricht ungefähr dem mittleren Abstand zwischen Erde und Sonne). Der größten Distanz, aus der bis heute ein Foto der Erde gemacht wurde.
wenn man dann von weit draussen im all auf die erde rückkoppelt, dabei eh schon ins grübeln kommt, endlos reinzoomt und – so man will – in Hornegg landet, den titel mit dem konkreten projekt verbindet, bildet sich das ab, worum es hier geht. eine ahnung von proportionen, bedeutung und momentaufnahme menschlicher kultur – ein artefakt aus historischer fassade und einer zeichnung. Dies steht in guter tradition meiner sehr gern frei assoziierten projekttitel oder so logisch zueinander wie der begriff ZEIT zu einer geometrischen spirale.“