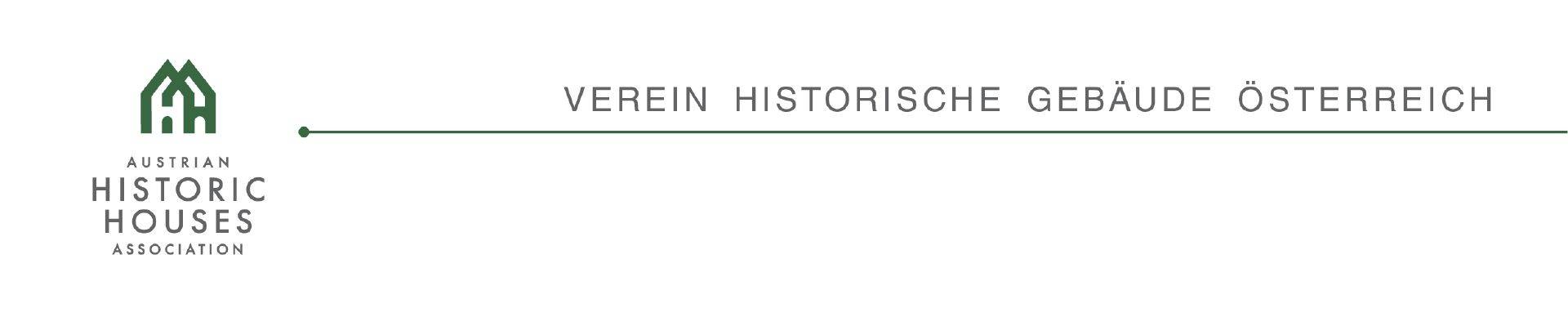Ein Artikel aus Der Standard 14.11.2018, der auch unter nachstehendem Link abrufbar ist:
https://derstandard.at/2000091209408/Privates-baukulturelles-Erbe-unter-Druck
Privates baukulturelles Erbe unter Druck
In Österreich beträgt die Sanierungsquote nur ein Prozent. Zur Werterhaltung historischer Bausubstanz braucht es allerdings eine Quote von drei Prozent
Was wäre Österreich ohne denkmalgeschützte Bauten? Ohne die reizenden Stadt- und Dorfkerne, ohne die Altstädte von Innsbruck, Salzburg, Enns, Dornbirn, Linz oder Graz? Ohne Stifte und Klöster? Graz ohne Uhrturm und Salzburg ohne Festung? Was wäre Österreich ohne Burgen, Schlösser, ohne die zahlreichen Objekte, die wir unser baukulturelles Erbe nennen und die ein unverzichtbarer Bestandteil unserer gemeinsamen lokalen und europäischen Identität sind?
Derzeit stehen in Österreich 39.000 unbewegliche Objekte rechtskräftig unter Denkmalschutz. Davon ist circa je ein Drittel im Eigentum von Privaten, von Religionsgemeinschaften sowie von Firmen, Stiftungen und öffentlichen Körperschaften.
Lösung gegen Bodenfraß
Die 13.000 denkmalgeschützten Immobilien ausschließlich in privater Eigentümerschaft haben immer mehr unter den völlig inadäquaten Bauvorschriften und hohem Kostenrisiko zu leiden. Viele historische Bauten sind bereits dem Verfall preisgegeben, weil immer mehr private Eigentümer mit der Erhaltung wirtschaftlich und finanziell überfordert sind. Baufachleute nennen als Ziel eine Sanierungsquote von jährlich drei Prozent zur Werterhaltung der historischen Bausubstanz. Derzeit liegt Österreich bei kaum einem Prozent, was langfristig zwangsläufig zum Einsturz, Abbruch und Verschwinden alter oft landschaftsprägender Bauten führt.
Dabei könnten denkmalgeschützte Häuser in bestehenden Stadt-, Markt- und Dorfkernen konkrete Lösungen zum immer wieder öffentlich kritisierten „Bodenfraß“ leisten. Derzeit wird in Österreich täglich eine Fläche von rund 20 Hektar verbaut. Das entspricht einer Fläche von etwa 30 Fußballplätzen. Befund der Statistik Austria: In den vergangenen 15 Jahren ist die österreichische Bevölkerung um kaum neun Prozent gewachsen, während im selben Zeitraum die verbauten Flächen um rund 24 Prozent wesentlich dynamischer zugenommen haben.
Bürokratie und Kostenrisiko minimieren
Das Thema der Erhaltung alter Gebäude im Privatbesitz wird immer drängender, weil der Druck auf Eigentümer, Planer und alle dafür Verantwortlichen durch eine Vielzahl von Gesetzen und Normen laufend wächst. Hauptproblem ist, dass viele für Neubauten bestimmte Normen genauso für alte Bürgerhäuser aus der Gotik-, Renaissance- oder Barockzeit Geltung haben – die technischen Bauvorschriften und Bauordnungen ebenso wie die Energiesparbestimmungen, Bestimmungen zu Barrierefreiheit und Feuerschutz, Wohnbauförderungsrichtlinien, aber auch Haftungsfragen.
Ein Denkmal ist kein Neubau und deshalb kostenintensiver. Der Präsident der oberösterreichischen Gesellschaft für Landeskunde und Denkmalpflege und vielgeprüfter Erneuerer von zahlreichen denkmalgeschützten Häusern, Schlössern und Objekten, Georg Spiegelfeld, forderte dazu kürzlich, „dass Bürokratie und Kostenrisiko so weit minimiert werden müssen, dass Investoren im Zweifelsfall sich eher für die Nutzung eines denkmalgeschützten Objektes entscheiden, statt an der Peripherie einer Stadt wertvollen landwirtschaftlichen Grund zu verbrauchen“.
Dafür sprechen auch rein volkswirtschaftliche Argumente, weil diese Bauten bereits alle Anschlüsse der Infrastrukturnetze haben, im Gegensatz zu Projekten auf der grünen Wiese: Kanal- und Wasserleitungen, Straßen, Strom, Energie, Glasfaserinternet sind im Bestand meist schon vorhanden. Kosten, die Gemeinden – zumindest teilweise – sparen könnten.
Keine bloße Liebhaberei
Erstes Ziel im noch laufenden „Europäischen Jahr des kulturellen Erbes 2018“ müsste sein, die besondere Problemlage auch im internationalen beziehungsweise europäischen Vergleich aufzuzeigen und konkrete Verbesserungsvorschläge zu präsentieren. Dabei muss vermerkt werden, dass im Arbeitsprogramm der Regierung dieses Thema auch enthalten ist und der zuständige Kulturminister dafür bereits Gesprächsbereitschaft bekundet hat.
Die Sanierung historischer Gebäude kostet mehr als ein Neubau. Das müsste im Steuer- und Abgabenrecht wegen des öffentlichen Interesses berücksichtigt werden. Daher zwei konkrete Forderungen:
- Weg mit der Liebhaberei-Vermutung, wenn das Bundesdenkmalamt bestätigt, dass die Investition im Sinne des Denkmalschutzes durchgeführt wurde.
- Sonderausgaben sollen in unbegrenzter Höhe für einen Eigentümer möglich sein, wenn er in ein Denkmal investiert.
Beide Punkte sind nachweislich auch ein Investitionsförderprogramm für Gewerbe und Handwerksberufe, wie erst kürzlich der Volkswirt der JKU-Linz, Friedrich Schneider, in einer Studie feststellte.
Arbeit für Handwerk und Gewerbe
So fließen bei einer Gesamtinvestition zur Sanierung eines Altbaus von einer Million Euro rund 600.000 Euro an Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsgebühren wieder in öffentliche Kassen zurück. Insbesondere deshalb, weil bei Bauten dieser Art praktisch keine Großmaschinen verwendet werden können, damit der Lohnanteil rund 90 Prozent und der Materialanteil etwa zehn Prozent beträgt. Damit würde sich ein Förderpaket des Staates mittelfristig weitestgehend „selbst tragen“, und die zurückfließenden Steuergelder würden keine zusätzlichen Budgetmittel erfordern.
Wenn ein Denkmaleigentümer zu wenig Kapital für die Erhaltung hat und Fremdkapital benötigt, soll ein Investitionsförderprogramm Kredite mit Bestkonditionen garantieren, wenn diese in die Denkmalpflege fließen. Auch die Grundsteuer für denkmalgeschützte Objekte soll fallen. Oft werben Gemeinden sogar mit Denkmälern. Damit könnten sie zumindest einen symbolischen Beitrag zur Denkmalpflege leisten.
Wert und Sinn
Investitionen in denkmalgeschützte Bauten fördern Österreichs Identität, Architektur, Regionalität, Tourismus, Arbeit, Beschäftigung und schonen Bauland auf der grünen Wiese. In ihnen stecken Wert und Sinn. Es gilt, unserer gemeinsamen europäischen Verantwortung für das baukulturelle Erbe in Österreich gerecht zu werden. (Gottfried Kneifel, 14.11.2018)